Warum Analphabetismus die Demokratie gefährden kann
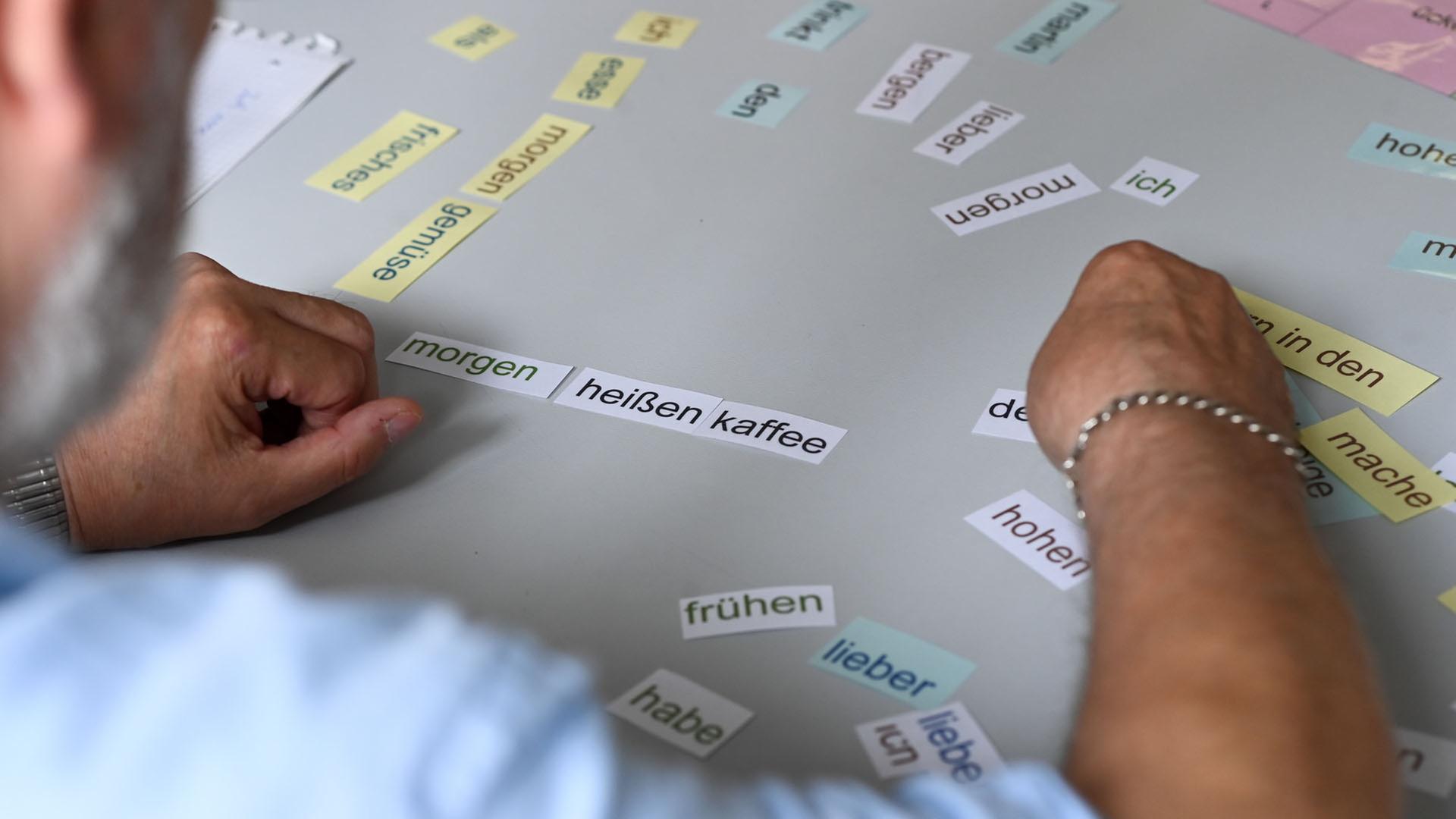
02.09.2025 05:09
Bis zu zehn Millionen Menschen in Deutschland haben massive Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben im Alltag. Hamburger Forscher warnen jetzt: Das kann auch politische Auswirkungen haben.
Von Armin Himmelrath, WDR
Peggy aus Berlin war eine von bis zu zehn Millionen Menschen in Deutschland, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, um im Alltag zurechtzukommen. Jahrelang trickste sie sich durch den Alltag, um mit ihren fehlenden Fähigkeiten nicht aufzufallen.
"Man hat sich dann vorher zu Hause entweder die Formulare aus dem Internet ausgedruckt und dann eine Freundin gefragt: Kannst du mir helfen? Und dann hat man das schon fertig gehabt und ist dann halt mit dem fertig ausgefüllten Formular zur Schule gegangen", erzählt die junge Frau über ihre Strategie. Erst als ihre Tochter in die Schule kam und beim Schreibenlernen immer wieder nach Hilfe fragte, habe sie sich selbst auch zu einem entsprechenden Kurs angemeldet.
Positive Bilanz
Das Happy End von Peggys Geschichte passt zur "Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung", die seit 2016 und noch bis zum kommenden Jahr in Deutschland läuft. In diesen zehn Jahren sollte das Thema besonders im Blick der Politik stehen.
Die Hamburger Bildungsforscherin und Professorin Anke Grotlüschen zieht für diese Dekade eine erste, vorsichtig positive Bilanz. Die Zahl der Betroffenen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten sei zwar nicht gesunken, aber immerhin stabil geblieben - angesichts der Entwicklungen in den vergangenen Jahren sei das ein Erfolg. Grotlüschen stützt sich dabei auf eine Neuauswertung der vorliegenden Daten zum Thema Literalität und funktionaler Analphabetismus.
Die Bundesrepublik habe sinnvoll in Bildung, Chancenausgleich und Erwachsenenbildung investiert, sagt die Forscherin. "Und wir sehen es, dass es in Deutschland trotz hoher Zuwanderung offensichtlich besser gelungen ist, die Stabilität zu halten, als im Vergleich zu Österreich." Deutschland habe eine große Integrations- und Literalitätsstrategie aufgelegt - und damit letztlich "doch eine vernünftige Willkommenskultur auf die Füße bekommen".
Die politische Dimension
Doch die Themen Alphabetisierung und Grundbildung, sagt Anke Grotlüschen, seien nicht nur eine Frage der persönlichen Fähigkeiten, sondern hätten auch eine hochgradig politische Bedeutung. Denn die Betroffenen hätten häufig das Gefühl verloren, sich am politischen Prozess beteiligen zu können. "Wir haben gefragt: Traut man sich zu, mitreden zu können, wenn es um Politik geht? Und das mögen Menschen nicht, die nicht gut literalisiert sind", sagt Grotlüschen.
"Wir haben gefragt: Wie ist es denn beim Amt? In der Behörde, wenn ihr widersprechen müsst? Das traut man sich dann auch nicht zu."
Besonders der Blick in andere Länder, in denen Rechtspopulisten an der Macht beteiligt sind, mache ihr Sorgen. "Populistische Parteiprogramme tendieren dazu, die Schwächeren allein zu lassen. Das betrifft insbesondere Menschen, die zugewandert sind: Für die gibt es keine strukturelle Unterstützung. Das heißt, es wird Spaltung im Bildungssystem betrieben."
Gewollte Strategie?
Diese Spaltung aber helfe den populistischen Parteien, sagt die Wissenschaftlerin: "Populistisch regierte Länder wie Ungarn, Polen, Italien oder auch Israel und USA sind alles Länder, die deutliche Verluste in den Literalitätswerten haben." Dort sei die Zahl der von Analphabetismus Betroffenen in den vergangenen Jahren deutlich größer geworden. "Und zumindest Ungarn, Polen und Israel investieren deutlich weniger in Weiterbildung."
Und das könne man fast schon als perfide Strategie bestimmter politischer Kreise interpretieren, sagt Grotlüschen. Denn aus populistischer Perspektive sei es eine hochgradig erfolgversprechende Strategie, wenn man sage: "Wir sorgen dafür, dass Menschen gering gebildet und einfache Leute sind, die uns das glauben müssen, was wir ihnen sagen - weil sie durch Lesen nicht zu einer anderen Meinung kommen können."
So gesehen, sagt die Bildungsforscherin, sei die Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung auch eine Dekade zur Stärkung der demokratischen Gesellschaft.
Über dieses Thema berichtete BR24 am 02. September 2025 um 07:50 Uhr.
Bis zu zehn Millionen Menschen in Deutschland haben massive Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben im Alltag. Hamburger Forscher warnen jetzt: Das kann auch politische Auswirkungen haben.
Von Armin Himmelrath, WDR
Peggy aus Berlin war eine von bis zu zehn Millionen Menschen in Deutschland, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, um im Alltag zurechtzukommen. Jahrelang trickste sie sich durch den Alltag, um mit ihren fehlenden Fähigkeiten nicht aufzufallen.
"Man hat sich dann vorher zu Hause entweder die Formulare aus dem Internet ausgedruckt und dann eine Freundin gefragt: Kannst du mir helfen? Und dann hat man das schon fertig gehabt und ist dann halt mit dem fertig ausgefüllten Formular zur Schule gegangen", erzählt die junge Frau über ihre Strategie. Erst als ihre Tochter in die Schule kam und beim Schreibenlernen immer wieder nach Hilfe fragte, habe sie sich selbst auch zu einem entsprechenden Kurs angemeldet.
Positive Bilanz
Das Happy End von Peggys Geschichte passt zur "Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung", die seit 2016 und noch bis zum kommenden Jahr in Deutschland läuft. In diesen zehn Jahren sollte das Thema besonders im Blick der Politik stehen.
Die Hamburger Bildungsforscherin und Professorin Anke Grotlüschen zieht für diese Dekade eine erste, vorsichtig positive Bilanz. Die Zahl der Betroffenen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten sei zwar nicht gesunken, aber immerhin stabil geblieben - angesichts der Entwicklungen in den vergangenen Jahren sei das ein Erfolg. Grotlüschen stützt sich dabei auf eine Neuauswertung der vorliegenden Daten zum Thema Literalität und funktionaler Analphabetismus.
Die Bundesrepublik habe sinnvoll in Bildung, Chancenausgleich und Erwachsenenbildung investiert, sagt die Forscherin. "Und wir sehen es, dass es in Deutschland trotz hoher Zuwanderung offensichtlich besser gelungen ist, die Stabilität zu halten, als im Vergleich zu Österreich." Deutschland habe eine große Integrations- und Literalitätsstrategie aufgelegt - und damit letztlich "doch eine vernünftige Willkommenskultur auf die Füße bekommen".
Die politische Dimension
Doch die Themen Alphabetisierung und Grundbildung, sagt Anke Grotlüschen, seien nicht nur eine Frage der persönlichen Fähigkeiten, sondern hätten auch eine hochgradig politische Bedeutung. Denn die Betroffenen hätten häufig das Gefühl verloren, sich am politischen Prozess beteiligen zu können. "Wir haben gefragt: Traut man sich zu, mitreden zu können, wenn es um Politik geht? Und das mögen Menschen nicht, die nicht gut literalisiert sind", sagt Grotlüschen.
"Wir haben gefragt: Wie ist es denn beim Amt? In der Behörde, wenn ihr widersprechen müsst? Das traut man sich dann auch nicht zu."
Besonders der Blick in andere Länder, in denen Rechtspopulisten an der Macht beteiligt sind, mache ihr Sorgen. "Populistische Parteiprogramme tendieren dazu, die Schwächeren allein zu lassen. Das betrifft insbesondere Menschen, die zugewandert sind: Für die gibt es keine strukturelle Unterstützung. Das heißt, es wird Spaltung im Bildungssystem betrieben."
Gewollte Strategie?
Diese Spaltung aber helfe den populistischen Parteien, sagt die Wissenschaftlerin: "Populistisch regierte Länder wie Ungarn, Polen, Italien oder auch Israel und USA sind alles Länder, die deutliche Verluste in den Literalitätswerten haben." Dort sei die Zahl der von Analphabetismus Betroffenen in den vergangenen Jahren deutlich größer geworden. "Und zumindest Ungarn, Polen und Israel investieren deutlich weniger in Weiterbildung."
Und das könne man fast schon als perfide Strategie bestimmter politischer Kreise interpretieren, sagt Grotlüschen. Denn aus populistischer Perspektive sei es eine hochgradig erfolgversprechende Strategie, wenn man sage: "Wir sorgen dafür, dass Menschen gering gebildet und einfache Leute sind, die uns das glauben müssen, was wir ihnen sagen - weil sie durch Lesen nicht zu einer anderen Meinung kommen können."
So gesehen, sagt die Bildungsforscherin, sei die Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung auch eine Dekade zur Stärkung der demokratischen Gesellschaft.
Über dieses Thema berichtete BR24 am 02. September 2025 um 07:50 Uhr.
Bis zu zehn Millionen Menschen in Deutschland haben massive Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben im Alltag. Hamburger Forscher warnen jetzt: Das kann auch politische Auswirkungen haben.
Von Armin Himmelrath, WDR
Peggy aus Berlin war eine von bis zu zehn Millionen Menschen in Deutschland, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, um im Alltag zurechtzukommen. Jahrelang trickste sie sich durch den Alltag, um mit ihren fehlenden Fähigkeiten nicht aufzufallen.
"Man hat sich dann vorher zu Hause entweder die Formulare aus dem Internet ausgedruckt und dann eine Freundin gefragt: Kannst du mir helfen? Und dann hat man das schon fertig gehabt und ist dann halt mit dem fertig ausgefüllten Formular zur Schule gegangen", erzählt die junge Frau über ihre Strategie. Erst als ihre Tochter in die Schule kam und beim Schreibenlernen immer wieder nach Hilfe fragte, habe sie sich selbst auch zu einem entsprechenden Kurs angemeldet.
Positive Bilanz
Das Happy End von Peggys Geschichte passt zur "Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung", die seit 2016 und noch bis zum kommenden Jahr in Deutschland läuft. In diesen zehn Jahren sollte das Thema besonders im Blick der Politik stehen.
Die Hamburger Bildungsforscherin und Professorin Anke Grotlüschen zieht für diese Dekade eine erste, vorsichtig positive Bilanz. Die Zahl der Betroffenen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten sei zwar nicht gesunken, aber immerhin stabil geblieben - angesichts der Entwicklungen in den vergangenen Jahren sei das ein Erfolg. Grotlüschen stützt sich dabei auf eine Neuauswertung der vorliegenden Daten zum Thema Literalität und funktionaler Analphabetismus.
Die Bundesrepublik habe sinnvoll in Bildung, Chancenausgleich und Erwachsenenbildung investiert, sagt die Forscherin. "Und wir sehen es, dass es in Deutschland trotz hoher Zuwanderung offensichtlich besser gelungen ist, die Stabilität zu halten, als im Vergleich zu Österreich." Deutschland habe eine große Integrations- und Literalitätsstrategie aufgelegt - und damit letztlich "doch eine vernünftige Willkommenskultur auf die Füße bekommen".
Die politische Dimension
Doch die Themen Alphabetisierung und Grundbildung, sagt Anke Grotlüschen, seien nicht nur eine Frage der persönlichen Fähigkeiten, sondern hätten auch eine hochgradig politische Bedeutung. Denn die Betroffenen hätten häufig das Gefühl verloren, sich am politischen Prozess beteiligen zu können. "Wir haben gefragt: Traut man sich zu, mitreden zu können, wenn es um Politik geht? Und das mögen Menschen nicht, die nicht gut literalisiert sind", sagt Grotlüschen.
"Wir haben gefragt: Wie ist es denn beim Amt? In der Behörde, wenn ihr widersprechen müsst? Das traut man sich dann auch nicht zu."
Besonders der Blick in andere Länder, in denen Rechtspopulisten an der Macht beteiligt sind, mache ihr Sorgen. "Populistische Parteiprogramme tendieren dazu, die Schwächeren allein zu lassen. Das betrifft insbesondere Menschen, die zugewandert sind: Für die gibt es keine strukturelle Unterstützung. Das heißt, es wird Spaltung im Bildungssystem betrieben."
Gewollte Strategie?
Diese Spaltung aber helfe den populistischen Parteien, sagt die Wissenschaftlerin: "Populistisch regierte Länder wie Ungarn, Polen, Italien oder auch Israel und USA sind alles Länder, die deutliche Verluste in den Literalitätswerten haben." Dort sei die Zahl der von Analphabetismus Betroffenen in den vergangenen Jahren deutlich größer geworden. "Und zumindest Ungarn, Polen und Israel investieren deutlich weniger in Weiterbildung."
Und das könne man fast schon als perfide Strategie bestimmter politischer Kreise interpretieren, sagt Grotlüschen. Denn aus populistischer Perspektive sei es eine hochgradig erfolgversprechende Strategie, wenn man sage: "Wir sorgen dafür, dass Menschen gering gebildet und einfache Leute sind, die uns das glauben müssen, was wir ihnen sagen - weil sie durch Lesen nicht zu einer anderen Meinung kommen können."
So gesehen, sagt die Bildungsforscherin, sei die Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung auch eine Dekade zur Stärkung der demokratischen Gesellschaft.
Über dieses Thema berichtete BR24 am 02. September 2025 um 07:50 Uhr.
Bis zu zehn Millionen Menschen in Deutschland haben massive Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben im Alltag. Hamburger Forscher warnen jetzt: Das kann auch politische Auswirkungen haben.
Von Armin Himmelrath, WDR
Peggy aus Berlin war eine von bis zu zehn Millionen Menschen in Deutschland, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, um im Alltag zurechtzukommen. Jahrelang trickste sie sich durch den Alltag, um mit ihren fehlenden Fähigkeiten nicht aufzufallen.
"Man hat sich dann vorher zu Hause entweder die Formulare aus dem Internet ausgedruckt und dann eine Freundin gefragt: Kannst du mir helfen? Und dann hat man das schon fertig gehabt und ist dann halt mit dem fertig ausgefüllten Formular zur Schule gegangen", erzählt die junge Frau über ihre Strategie. Erst als ihre Tochter in die Schule kam und beim Schreibenlernen immer wieder nach Hilfe fragte, habe sie sich selbst auch zu einem entsprechenden Kurs angemeldet.
Positive Bilanz
Das Happy End von Peggys Geschichte passt zur "Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung", die seit 2016 und noch bis zum kommenden Jahr in Deutschland läuft. In diesen zehn Jahren sollte das Thema besonders im Blick der Politik stehen.
Die Hamburger Bildungsforscherin und Professorin Anke Grotlüschen zieht für diese Dekade eine erste, vorsichtig positive Bilanz. Die Zahl der Betroffenen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten sei zwar nicht gesunken, aber immerhin stabil geblieben - angesichts der Entwicklungen in den vergangenen Jahren sei das ein Erfolg. Grotlüschen stützt sich dabei auf eine Neuauswertung der vorliegenden Daten zum Thema Literalität und funktionaler Analphabetismus.
Die Bundesrepublik habe sinnvoll in Bildung, Chancenausgleich und Erwachsenenbildung investiert, sagt die Forscherin. "Und wir sehen es, dass es in Deutschland trotz hoher Zuwanderung offensichtlich besser gelungen ist, die Stabilität zu halten, als im Vergleich zu Österreich." Deutschland habe eine große Integrations- und Literalitätsstrategie aufgelegt - und damit letztlich "doch eine vernünftige Willkommenskultur auf die Füße bekommen".
Die politische Dimension
Doch die Themen Alphabetisierung und Grundbildung, sagt Anke Grotlüschen, seien nicht nur eine Frage der persönlichen Fähigkeiten, sondern hätten auch eine hochgradig politische Bedeutung. Denn die Betroffenen hätten häufig das Gefühl verloren, sich am politischen Prozess beteiligen zu können. "Wir haben gefragt: Traut man sich zu, mitreden zu können, wenn es um Politik geht? Und das mögen Menschen nicht, die nicht gut literalisiert sind", sagt Grotlüschen.
"Wir haben gefragt: Wie ist es denn beim Amt? In der Behörde, wenn ihr widersprechen müsst? Das traut man sich dann auch nicht zu."
Besonders der Blick in andere Länder, in denen Rechtspopulisten an der Macht beteiligt sind, mache ihr Sorgen. "Populistische Parteiprogramme tendieren dazu, die Schwächeren allein zu lassen. Das betrifft insbesondere Menschen, die zugewandert sind: Für die gibt es keine strukturelle Unterstützung. Das heißt, es wird Spaltung im Bildungssystem betrieben."
Gewollte Strategie?
Diese Spaltung aber helfe den populistischen Parteien, sagt die Wissenschaftlerin: "Populistisch regierte Länder wie Ungarn, Polen, Italien oder auch Israel und USA sind alles Länder, die deutliche Verluste in den Literalitätswerten haben." Dort sei die Zahl der von Analphabetismus Betroffenen in den vergangenen Jahren deutlich größer geworden. "Und zumindest Ungarn, Polen und Israel investieren deutlich weniger in Weiterbildung."
Und das könne man fast schon als perfide Strategie bestimmter politischer Kreise interpretieren, sagt Grotlüschen. Denn aus populistischer Perspektive sei es eine hochgradig erfolgversprechende Strategie, wenn man sage: "Wir sorgen dafür, dass Menschen gering gebildet und einfache Leute sind, die uns das glauben müssen, was wir ihnen sagen - weil sie durch Lesen nicht zu einer anderen Meinung kommen können."
So gesehen, sagt die Bildungsforscherin, sei die Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung auch eine Dekade zur Stärkung der demokratischen Gesellschaft.
Über dieses Thema berichtete BR24 am 02. September 2025 um 07:50 Uhr.